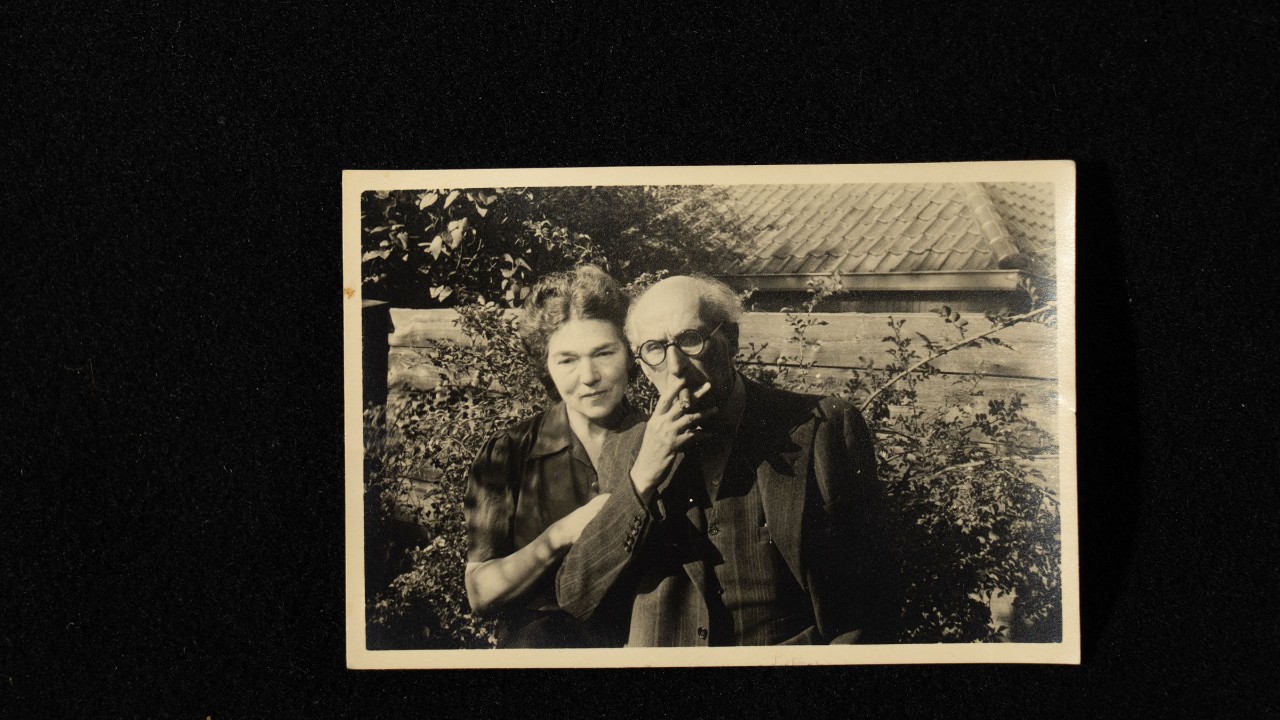Am 8. November hatte sich die IG Metall für Warnstreiks entschieden. Der Grund: Auch in der zweiten Verhandlungsrunde am 7. November verweigerten die Arbeitgeber ein Angebot. Die IG Metall fordert für die 75 000 nordwestdeutschen Stahlbeschäftigten sieben Prozent mehr Geld, die unbefristete Übernahme für Auszubildende und eine verbesserte Altersteilzeit.
Doch können Warnstreiks was bewirken und sind sie rechtlich überhaupt zulässig? Die IG Metall gibt Antworten darauf.
Was ist ein Warnstreik?
Bei einem Warnstreik handelt es sich um eine befristete Arbeitsniederlegung von einigen Stunden. Damit wollen die IG Metall und die aufgerufenen Beschäftigten die Arbeitgeber zu einem Angebot bewegen oder gegen ein zu geringes Lohnangebot protestieren. Die Warnstreiks während einer Tarifrunde sind notwendig. Die Belegschaften signalisieren damit den Arbeitgebern, dass sie hinter den Tarifforderungen stehen. Gleichzeitig erzeugen sie den nötigen Druck, um gute Tarifstandards durchzusetzen. Denn – in Zeiten kurzfristiger Planungen und knapper Lieferfristen – können auch befristete Warnstreiks Unternehmen ökonomisch erheblich treffen.
Sind Warnstreiks zulässig?
Nach Ablauf der Friedenspflicht können Gewerkschaften zu Warnstreiks aufrufen. Warnstreiks sind wie Vollstreiks verfassungsrechtlich als Grundrecht garantiert. Das Streikrecht leitet sich ab von der „Koalitions- und Vereinsfreiheit“, die im Grundgesetz in Artikel 9 Absatz 3 verankert ist. Das bedeutet: Jeder Arbeitnehmer und jeder Auszubildender, ob gewerkschaftlich organisiert oder nicht, darf sich an einem Warnstreik beteiligen. Die Teilnahme verletzt nicht den Arbeitsvertrag. Die Arbeitgeber dürfen Warnstreikende nicht maßregeln und weder während des Streiks noch danach kündigen.
Was ist eine Friedenspflicht?
Vereinbarte und noch laufende Tarifverträge unterliegen der Friedenspflicht. Das bedeutet: Während der Laufzeit eines Tarifvertrages darf dieser nicht durch Arbeitskämpfe oder Aktionen in Frage gestellt werden. Die Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände sind verpflichtet, sich daran zu halten. Die Friedenspflicht endet zeitgleich mit dem Tarifvertrag. In der Metall- und Elektrobranche endet sie vier Wochen nach Ablauf des Tarifvertrages. Ist die Frist der Friedenspflicht abgelaufen, sind Warnstreiks möglich.
Was unterscheidet einen Warnstreik von einem regulären Streik?
Ein Warnstreik ist zeitlich auf einige Stunden befristet, zu dem eine Gewerkschaft ohne ein Mitgliedervoutum aufrufen kann. Bleiben die Warnstreiks ohne Erfolg und führen zu keinem Tarifergebnis, kann die IG Metall-Tarifkommission das Scheitern der Verhandlungen erklären. Sie beantragt daraufhin beim Vorstand der IG Metall eine Urabstimmung für einen Vollstreik. Votieren mindestens 75 Prozent der aufgerufenen Mitglieder für einen Streik, legt der Vorstand den Streikbeginn fest. Der Streik ist erst einmal unbefristet.
Wer zahlt während des Streiks Lohn und Gehalt?
Während des Streiks hat der Streikende keinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung. IG Metall-Mitglieder erhalten von ihrer Gewerkschaft Streikgeld. Das beträgt im Schnitt zwei Drittel des Bruttoeinkommens. Wieviel es genau ist, errechnet der IG Metall-Leistungsrechner.
Und wie geht’s weiter?
Während eines Streiks führen die Tarifparteien ihre Verhandlungen fort. Haben sie sich auf ein Ergebnis geeinigt, stimmen die Mitglieder erneut in einer Urabstimmung darüber ab. Entscheiden sich 25 Prozent für die Annahme, gilt ein neuer Tarifvertrag und der Streik wird beendet.
Wirkt ein Streik negativ nach?
Zum Schutz der Beschäftigten vereinbaren die Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände nach Streikende eine „Maßregelungsklausel“. Danach dürfen Unternehmer Streikbeteiligte nicht maßregeln. Eventuelle Abmahnungen, Kündigungen oder Verweigern von Prämienzahlungen sind wirkungslos bzw. müssen sie zurücknehmen.